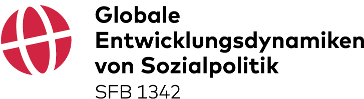Lieber Herr Schlichte, für das Teilprojekt B09 waren sie kürzlich für rund zwei Monate in Uganda. Was war das Ziel des Aufenthalts?
Es ging mir darum, ein allgemeines Mapping zu machen. Denn die Sozialpolitik in Afrika ist bei Weitem nicht so erforscht wie in der OECD oder Europa. Und es gibt dort Formen von Sozialpolitik, die im Globalen Norden weniger präsent sind, wie etwa die Subventionierung von Grundnahrungsmitteln oder die Vorbeugung von Epidemien. Mein Ziel war also, dazu Stimmen zu sammeln: Was denken die Menschen über die sozialpolitischen Verhältnisse in Uganda? Wie sind die Positionen der Regierungsseite? Was denken die Krankenschwestern, Ärzte oder Lehrergewerkschaften? Ich wollte aber auch wissen, wie "ordinäre" Leute, also Nicht-Experten, im Alltag mit der Frage von Krankheit und Gesundheitsvorsorge umgehen. Es gab dabei keine übergeordnete Fragestellung: Beim Mapping versucht man, eine Collage zusammenzustellen und offen zu sein für alles, was sich ergibt.
Aber Sie sind doch sicher nicht unvorbereitet nach Uganda geflogen ...
Das natürlich nicht. Ich habe früher schon in Uganda zu anderen Themen gearbeitet und habe deshalb eine ganze Reihe von Kontakten. Dennoch wollte ich nicht mit einer engen Fragestellung auf die Materialsuche gehen. Wir nennen das Feldforschung, hochtrabend könnte man es auch Ethnographie nennen. Natürlich mache ich auch Experteninterviews, aber die Alltagsgeschichten gehören genauso dazu wie all das, was in der Zeitung steht und was die Leute beiläufig erzählen. Außerdem sammle ich alle möglichen Dokumente, informelle Papiere zum Beispiel von in Uganda tätigen Entwicklungshilfeorganisationen. Die Annahme ist: Alles ist Material. Alles, was man sieht, hört und findet. Es gibt da keine Grenze.
Sie sind also mit einem Koffer nach Kampala geflogen und mit fünf Koffern heimgekehrt? Oder ernsthaft: Wie dokumentieren Sie beim Mapping Ihre Arbeit?
Früher, als alle Unterlagen noch gedruckt waren, habe ich tatsächlich Postsäcke gepackt und nach Deutschland verschickt. Aber das ist natürlich heute auch in Uganda fast alles digitalisiert und passt alles auf einen USB-Stick und in ein paar Mappen.
Und die Gespräche mit Menschen schneiden Sie mit?
Manchmal. Die meisten allerdings nicht. Viele Gespräche sind Alltagskonversationen, da wäre es sehr merkwürdig, anderen mit dem Mikro vor der Nase herum zu hantieren. Ich mache mir in der Regel in Gesprächen Notizen und schreibe hinterher alles ausführlich auf. Das ergibt dann später ein Transkript des Gesprächs. Entscheidend ist, dass ich mich gleich hinsetze. Deshalb gehe ich nach Gesprächen sofort ins Café, nach Hause oder in die Bibliothek und schreibe ein Gesprächsprotokoll auf der Grundlage der Notizen.
Gab es etwas auf Ihrer Reise, dass Sie überrascht hat?
Was mich überrascht hat ist, dass sämtliche „policies“ unheimlich stark der Demokratiemaschine Ugandas unterworfen ist. Das geht so weit, dass viele ugandische Experten mittlerweile an der Demokratisierung zweifeln, weil der politische Wettbewerb so scharf geworden ist, dass er Interferenzen in allen möglichen Politiken kreiert.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Nehmen wir die Polizeiarbeit in Uganda. Während der Wahlkämpfe ist die gesamte Polizei im Auftrag der Regierung unterwegs. Alles wird eingesetzt, damit der Präsident geschmeidig durch das Land reisen kann und die Massen organisiert werden können, um ihm zuzujubeln. Dabei bleibt die normale Polizeiarbeit auf der Strecke, wobei die Ressourcen der Polizei ohnehin nicht üppig sind. Dieses Prinzip erstreckt sich aber auch auf die Schulen und die Gesundheitsversorgung. Man generiert politische Unterstützung über die Verteilung der ohnehin knappen öffentlichen Ressourcen. Das kennen wir zwar auch aus Deutschland auch: bestimmte Regionen und Fraktionen werden mit Mitteln ausgestattet, um Loyalität zu erzeugen. In Uganda geschieht das in radikaler Form, was mit der verbreiteten Armut zu tun hat. Die Amtsinhaber setzen den gesamten Staat für den politischen Wettbewerb in Gang. Sogar intellektuelle, liberale und fortschrittliche Leute sagten mir, man sollte weniger wählen und in größeren Abständen, weil zu viel Geld und zu viele Ressourcen verpulvert werden für die Herstellung von Loyalität. Mich hat überrascht, wie kritisch die Stimmung mittlerweile gegenüber demokratischen Verfahren ist.
Wahlen finden in Uganda finden alle fünf Jahre statt.
Ja, in der Regel amtiert der Präsident fünf Jahre, auch das Parlament wird alle fünf Jahre gewählt. Das klingt nach einem entspannten Rhythmus. Aber die Loyalität muss auch zwischendrin gesichert werden. Man braucht Parlamentsmehrheiten. Und das Parlament nicht so stark durch Parteien diszipliniert wie bei uns, sondern die Loyalität von Abgeordneten wird auch gesteuert über den Bau von Krankenhäusern, Straßen und dergleichen. Denn die Abgeordneten stehen unter einem gewissen Druck, ihrem Wahlkreis etwas liefern zu müssen.
Womit wir bei der der Sozialpolitik wären.
Wo werden die Krankenhäuser gebaut? Wo sie nötig sind, oder wo der Abgeordnete wohnt, dessen Unterstützung gebraucht wird? Diese Logik hat mich überrascht. Ich glaube, Uganda ist da kein Einzelfall, man wird das in ganz vielen Staaten beobachten können, auch weit über Afrika hinaus: Das politische Establishment ist gleichzeitig auch unternehmerisches Establishment. Zum Beispiel ist der Permanent Secretary of State im Bildungsministerium gleichzeitig der Besitzer von mehreren privaten Secondary Schools. Ähnliches sieht man bei vielen Parlamentsabgeordneten. Das sind politische Unternehmer, die mit der Privatisierung von Bildung und Gesundheit stark verknüpft sind. So ist eine Oligarchie entstanden, die gar kein Interesse daran haben kann, Bildung und Gesundheit wieder zum öffentlichen Gut zu machen. Der boomende Markt gerade für Bildung in Uganda ist fest in der Hand derer, die auch politisch das Sagen haben. Eine Locked-in-Situation, die so arretiert ist, dass man sich fragt: Wie soll sich das jemals wieder ändern? Das ist vielleicht eine zweite These, die aus dem Aufenthalt hervorgegangen ist.
Ich stelle es mir schwierig vor, solche Dinge wie die Verquickungen des Permanent Secretary of State im Bildungsministerium vor Ort zu verifizieren.
So etwas sagen einem die Menschen natürlich nicht ins Mikrofon, sondern im Vertrauen. Aber man kann so etwas genauso verifizieren wie beispielsweise in Deutschland, indem man zur Handelskammer geht und nachschaut, wer dort als Unternehmer für was eingetragen ist.
Ich frage deshalb, weil Ihr Kollege Roy Karadag in Ägypten ein ähnliches Mapping versucht hat und zumindest bei Behörden und Ministerien abgeblockt wurde.
Das ist in Uganda ganz anders. Bei Behörden und Ministerien muss man sich am Empfang registrieren, aber dann kann man sich – und das macht es für die Forschung eben unheimlich leicht - im Gebäude völlig frei bewegen. Man klopft einfach an die Türen. Man muss vielleicht warten oder am nächsten Tag wiederkommen, aber es gibt grundsätzlich immer Gesprächsbereitschaft. Uganda ist da viel liberaler als zum Beispiel Deutschland.
Bei Ihrer Mapping-Methode sind Sie auch auf Zufälle angewiesen. Ein solcher Zufall hat Sie mit dem ugandischen Krankenhaussystem vertraut gemacht. Würden Sie das kurz erzählen?
In Kampala habe ich bei einer ehemaligen Doktorandin gewohnt, die Zimmer untervermietet. In dem Haus wohnte neben einer Nachrichtensprecherin auch der Onkel meiner Vermieterin, der vom Land nach Kampala gekommen war, weil er Zungenkrebs hatte. Sein Beispiel machte mir deutlich, wie das Gesundheitssystem Ugandas System funktioniert und welche Rolle Familie, Verwandtschaft und Freundschaft als Funktionsprinzip der sozialen Sicherung spielen. Uganda hat etwa 40 Millionen Einwohner. Für Menschen, die keine private Krankenversicherung haben und sich Operationen nicht leisten können – also etwa 98 Prozent der Bevölkerung -, gibt es im gesamten Land genau eine Station, wo Krebsoperationen möglich sind. Der Onkel wäre gestorben, wenn seine Nichte nicht einen Job hätte, durch den sie den Krankenhausaufenthalt finanzieren konnte. Das war die erste Bedingung, warum er heute noch lebt. Die zweite war, dass in dem Krankenhaus 20 Ärzte aus Chicago zwei Wochen lang ohne Entgelt operierten - Tag und Nacht im Wechselschichtbetrieb. Nur deshalb war die Operation zu dem Zeitpunkt möglich. Denn die meisten Ärzte und Pfleger, die in den öffentlichen Krankenhäusern Ugandas arbeiten, können von ihrem Gehalt nicht leben, weshalb sie auch noch in Privatkliniken tätig sind. Das erklärt, warum Krebsoperationen in Uganda nicht in der Geschmeidigkeit ablaufen, wie das bei uns der Fall ist.
Wie ging es mit dem Mann weiter?
Es gibt keine Reha-Kliniken in Uganda, daher wurde er ein paar Tage nach der Operation entlassen. Für jemanden vom Land stellt sich dann die Frage: Wie kommt man aus dem Krankenhaus wieder nach Hause? Das Medianeinkommen in Uganda liegt bei 55.000 Schilling im Monat, umgerechnet etwa 25 Euro. Der Transport von Kampala aufs Land, sagen wir mal 400 Kilometer weit, kostet etwa 30.000 Schilling, also ein mittleres Monatseinkommen. Viele Patienten sind deshalb auf Hilfe angewiesen. Und so schießen wildfremde Menschen noch am Krankenhaus solchen Patienten etwas zu. Das klingt jetzt romantisch, hat aber auch eine Schattenseite: Denn diese Art von moralischen Verpflichtungen sind auch der Hintergrund dessen, was wir als Korruption denunzieren. Irgendwo muss das Geld schließlich herkommen. Wenn es Massenarmut gibt, gibt es auch Korruption – nicht, weil die Leute schlecht sind, sondern im Gegenteil: Weil umverteilt werden muss und der Zugang zu öffentlichen Ressourcen der wichtigste Zugang zu Ressourcen überhaupt ist.
Wie all das im Gesundheitssektor miteinander verschränkt ist, war mir vorher nicht so klar. Das ist vielleicht der wichtigste Grund für diese Form von Forschung. Für Experteninterviews müsste ich nicht nach Kampala fliegen. Was ich dort suche, sind eher „geplante“ Irritationen. So entdecke ich Dinge und Zusammenhänge, von denen ich vorher wenig wusste, die aber wichtig sind.
Wie schließt sich jetzt Ihre weitere Arbeit daran an?
Nach dem Sammeln des Materials in Uganda gibt eine Phase der Distanzierung. Vieles entdeckt man erst, wenn man sich das Material später wieder anguckt, auch weil man inzwischen andere Sachen gelesen und sich mit anderen unterhalten hat. Ich habe vor 20 Jahren angefangen, mich mit Uganda zu beschäftigen, und die Aufzeichnung von damals sind immer noch auskunftsreich. Ich werde jetzt einen Aufsatz zu Uganda [Anmerkung: Könnten Sie das etwas genauer sagen, worum es in dem Aufsatz gehen wird?] und einen zur kolonialen Sozialpolitik schreiben. Bis Sommer werden die Manuskripte fertig sein. Unsere Forschung in dem Teilprojekt B09 hat aber auch eine historische Dimension. Wir wollen das Auf und Ab von Sozialpolitiken in sechs afrikanischen Ländern erfassen und analysieren. Dann halten wir die Analysen nebeneinander. Gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Was geschieht zeitgleich, was phasenversetzt und warum? Welche äußeren Einflüsse gibt es? Sind sie gleichgerichtet oder widersprüchlich? Das sind die Fragen, die wir in der ersten SFB-Förderphase klären werden. Aber wir wollten jetzt schon durch das Mapping erkunden, welche Entwicklungen es in der Sozialpolitik in Afrika gibt und welche Fragen sich daraus ergeben, die wir in der zweiten Phase des SFB bearbeiten können.
Kontakt:
Prof. Dr. Klaus Schlichte
SFB 1342: Globale Entwicklungsdynamiken von Sozialpolitik, Institut für Interkulturelle und Internationale Studien
Mary-Somerville-Straße 7
28359 Bremen
Tel.: +49 421 218-67475
E-Mail: kschlich@uni-bremen.de